
Die Palästinenser dürfen in der deutschen Erinnerungspolitik nicht vorkommen
Anmerkungen zu Charlotte Widemanns Buch Den Schmerz der Anderen begreifen. Holocaust und Weltgedächtnis
Arn Strohmeyer
Die deutsche Erinnerungskultur ist ins Gerede gekommen und bedarf einer dringenden Korrektur. Die Publizistin Charlotte Wiedemann hat ein wichtiges Buch zum Thema geschrieben, das aufzeigt, in welche Richtung das Gedenken – vor allem an die Opfer des Holocaust, aber auch die des Kolonialismus – nehmen muss, wenn es nicht in Routine und dem „Nachsprechen einschlägiger Floskeln“ erstarren soll. Das gilt vor allem für die staatliche Erinnerungspolitik, der als Preis ihres Erfolges – denkt man etwa an das gemeinsame Gedenken mit Israel – eine „erstickende Umarmung“ drohe.
Die Autorin treibt vor allem die Frage um, warum es so schwer ist, den „Schmerz der Anderen zu begreifen“ – so auch der Titel des Buches. In Deutschland steht das Gedenken an den Holocaust mit Staatsräson-Charakter im Zentrum der Erinnerungskultur, was aber zugleich die automatische Abwertung anderer Leiden bedeutet. Die weitgereiste Autorin hat in vielen Ländern der Welt festgestellt, dass dort aus ganz verschiedenen Perspektiven auf die Vernichtung der europäischen Juden durch die Nazis geblickt wird und damit auch auf Israel. Das gilt etwa für die früher von europäischen Mächten kolonisierten Staaten Afrikas und Asiens, in denen die Sicht auf die eigenen Leiden im Vordergrund steht und nicht der Holocaust.
Die Autorin führt viele Beispiele für diesen Tatbestand an: Algerien, China, Indonesien, Kambodscha und Malaysia und Südafrika, geht aber auch ausführlich auf die Sklaverei und die rassistische Behandlung der Schwarzen in den USA ein. Auf die Frage, warum es eine Spaltung der Empathie den Leidenden gegenüber gibt, zieht die Autorin eine psychologische Erklärung heran: Empathie kann nur stattfinden, wenn eine minimale kulturelle Ähnlichkeit oder Gleichartigkeit mit den Opfern empfunden werden kann. Mit den jüdischen Opfern des Holocaust ist so gesehen eine Empathie möglich, kaum aber mit den Sinti und Roma, deren Volk im Holocaust auch furchtbare Verluste hinnehmen musste – über die Hälfte seines Bestandes.
Ein gutes Beispiel für Empathie sind auch die großen Sympathien für die durch Putins Krieg bedrängten Ukrainer, die aus der europäischen Kultur kommen: christlich, weiß und zumeist blauäugig, ganz im Gegenteil zu den durch Israels brutale Politik genauso bedrängten Palästinensern, für die sich nur wenige Menschen engagieren. Die Nicht-Empathie gilt auch für die millionenfachen Opfer des Kolonialismus, sodass man von einer Hierarchie der Empathiervergabe sprechen kann: Große Anteilnahme für die Einen, Nichtbeachtung und Vergessen der Anderen.
Wenn das so ist, gelten offenbar nur jüdische Opfer als gleichwertig, denen gegenüber man Schuld empfinden kann, nicht aber gegenüber Sinti und Roma, Schwarzen sowie Arabern. Die Autorin merkt dazu an: „Richtungen, in die Empathie fließen kann, werden eingeübt, und es gibt andere Richtungen, wo der Fluss blockiert ist und sich allenfalls Rinnsale den Weg suchen.“ Die amerikanische Philosophin Judith Butler hat für Menschen, denen keine Empathie entgegengebracht wird, den Begriff der Betrauerbarkeit eingeführt. Ein Leben, das nicht betrauert wird, hat so gesehen quasi nie existiert, hat als Leben nie wirklich gezählt. Menschen dieser Kategorie führen ein fragliches, fragwürdiges von Beginn an prekäres Leben: als hätten sie nie existiert, und keine Lobby setzt sich für sie ein. Diesen Menschen wird von ihren Unterdrückern bzw. Kolonisten sogar ihr historische Gedächtnis genommen, sie werden aus ihrer eignen Geschichte sozusagen exiliert.
Genau das macht Israel mit den Palästinensern. Der zionistische Staat versucht, sie aus der Gemeinschaft der Menschen herauszudrängen, ihnen ihre Identität zu nehmen, ihr historisches Gedächtnis zu zerstören. Alles, um den homogenen jüdischen Staat auf dem Land Erez Israel durchzusetzen, auf dem es möglichst keine Anderen (eben Palästinenser) mehr geben soll. Dieses Volk, das nichts mit dem Holocaust zu tun hatte, hat durch den Verlust seines Landes und seiner Kultur den höchsten Preis für dieses von Europäern verübte Verbrechen gezahlt. Und seine Leiden unter der gewaltsamen israelischen Herrschaft dauern weiter an. Deshalb fällt es den Palästinensern schwer, Empathie für die jüdischen Leiden – etwa im Holocaust erlittene – aufzubringen. Sie dürfen nicht einmal das Narrativ ihrer Leiden in Israel oder Deutschland vorbringen. Die Zionisten haben es mit ihrer Propaganda (Hasbara) geschafft, dass alles Palästinensische mit „antisemitisch“ gleichgesetzt wird.
Die Autorin nennt die den zionistischen Staat betreffenden Fakten – Vertreibung, Besatzung, Unterdrückung, Landraub, Segregation, eben Apartheid – sehr deutlich beim Namen. Und sie kritisiert auch sehr scharf die deutsche Erinnerungspolitik, die eng mit der Akzeptanz von Israels Politik zusammenhängt: „In der offiziellen Erinnerungskultur gibt es für diese Biografien [von palästinensischen Flüchtlingen vor den Zionisten] keinen Ort, solange Deutschland für die israelische Staatsgründung ein Passepartout benutzt, in dem nur die Shoa Platz hat. Die Vertreibung der Palästinenser ist ein historischer Kollateralschaden, außerhalb unserer Zuständigkeit, jenseits unseres Mitgefühls. Logisch ist das nicht: Gerade wenn der Holocaust als die alles andere überschattende Ursache der Staatsgründung betrachtet wird, wäre die Nakba [die Vertreibung der Palästinenser durch die Zionisten 1948] auch ein Teil unserer Geschichte, Teil einer gemeinsamen Geschichte. Doch steht dagegen ein Bedürfnis, das erstaunlicherweise mit der Zeit eher größer wird als kleiner: nämlich das Verhältnis zu Israel als exklusive Zweierbeziehung zu sehen, als ein deutsch-jüdisches Wunder der Versöhnung.“
Diese sehr berechtigte Kritik am deutschen Gedenken ordnet sich in das Gesamtkonzept des Buches ein: Immer wieder betont die Autorin ihr Ziel: einen Beitrag zu leisten zu einer pluralen Erinnerungskultur, die keine Hierarchien der Leiden kennt, also ein „Plädoyer für die prinzipielle Gleichrangigkeit“ historischer Leiderfahrungen und für ein an Inklusion und Solidarität orientiertes Weltgedächtnis, wobei die Autorin die zentrale Stellung des Holocaust gar nicht aufgehoben wissen will.
Das ist human gedacht und entspricht Bestrebungen von Historikern in anderen Staaten. Die Autorin leuchtet aber den Hintergrund gerade des offiziellen Holocaust-Erinnerns nicht vollständig aus. Denn Israel hat ein sehr spezielles Verhältnis zu dem Genozid an den europäischen Juden: Es hat ihn von Anfang an für seine politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Zwecke instrumentalisiert. Schon die Toten des Holocaust mussten sich, obwohl sie keineswegs alle Zionisten waren, gefallen lassen, als die eigentlichen Begründer des Staates Israel angesehen zu werden. Der Staat hatte und hat also Vorrang vor dem Holocaust, der Holocaust ist also lediglich Mittel zum Zweck, um Vorteile jeder Art daraus zu ziehen. Selbst die brutale Politik gegenüber den Palästinensern wird mit dem Holocaust gerechtfertigt. („Wir haben den Holocaust durchgemacht, uns ist deshalb alles erlaubt!“) Das ist keine böse antisemitische Kritik an der Politik dieses Staates von außen, sondern ist nachzulesen bei israelischen Autoren wie Abraham Burg, Yehuda Elkana, Gideon Levy, Ilan Pappe, Shlomo Sand, Tom Segev, Avi Shlaim und anderen.
Erinnern an den Holocaust ist nur dann authentisch, wenn es zweck- und absichtsfrei, also keine instrumentalisierenden Ziele verfolgt. Moshe Zuckermann hat es so definiert: „Erinnerung kann nur dann als legitim bezeichnet werden, wenn sie Opfer im Stande ihres Opfer-Seins und die Täter im Stande ihres Täter-Seins erinnert. Das bedeutet aber, jene historischen Zusammenhänge zu ergründen, welche Menschen letztlich Täter bzw. Opfer hat werden lassen.“ Genau das ist das israelische Gedenken aber nicht, weil es immer zweckgebunden, nationalistisch-zionistisch, also partikularistisch und eben nicht universalistisch ist, d.h. eben nicht die Opfer aller Genozide mit einbezieht.
Auf der Basis der äußerst engen deutsch-israelischen politischen Verflechtung, die deutscherseits auf der Vorstellung beruht, durch die totale Identifizierung mit Israel Erlösung von der durch den Holocaust verursachten Schuld zu erlangen, hat das deutsche Erinnern genau die Parameter des zionistischen Erinnerns übernommen und zu einem Staatsdogma erhoben.
Der deutsch-jüdische Publizist Alfred Grosser hat einmal geschrieben, man dürfe Auschwitz nur gedenken, wenn man gleichzeitig für die Gleichheit aller Menschen überall auf der Welt eintrete. Das ist die zwingende Konsequenz aus dem Holocaust, die Israel mit seiner rassistischen Verachtung und Unterdrückung der Palästinenser aber in keiner Weise erfüllt. Deshalb ist das zionistische Erinnern an den Holocaust so fragwürdig – und das deutsche Gedenken ebenso, weil es mit dem zionistischen völlig identisch ist. Die offizielle deutsche Erinnerungspolitik mit ihrem Festhalten an der Einzigartigkeit dieses Mega-Verbrechens ist das Fundament der deutschen Politik, aber sie ist wegen des völligen Ausschlusses der Palästinenser mit ihren völkerrechtlich abgesicherten Ansprüchen auf Freiheit und Selbstbestimmung genauso partikularistisch wie die zionistische, auch wenn sie behauptet, universalistisch zu sein.
Da die deutsche Politik alle völkerrechts- und menschenrechtswidrigen Verbrechen Israels mitträgt, ist auch ihr Holocaust-Gedenken in eine tiefe Krise geraten. Der israelische Historiker Ilan Pappe merkte kürzlich an, dass Deutschland so gut wie alle internationalen Verträge unterzeichnet habe, die es zur Einhaltung von Völkerrecht und Menschenrechten verpflichte, durch die enge symbiotische Allianz mit Israel sei es mit seiner Nahostpolitik aber immer tiefer auf den abschüssigen Weg des moralischen Verfalls auf die falsche Seite der Geschichte gerutscht. Für das deutsche Holocaust-Gedenken hat das fatale Folgen: Es ist keine freie Erinnerung auf dem Feld der Kultur, sondern ein Erinnerungsdiktat, das mit der Macht des Staates durchgesetzt wird (Norman Paech). Widerspruch und Abweichungen vom Dogma werden inquisitorisch als „antisemitisch“ stigmatisiert. Damit wird der politischen Kultur in Deutschland (Stichworte: Meinungs-, Informations-, Versammlungs- und Kunstfreiheit) schwerer Schaden zugefügt und dem wirklichen Kampf gegen den Antisemitismus ein Bärendienst erwiesen.
Charlotte Wiedemann spricht diese desaströse Entwicklung so nicht an, sie glaubt aber daran, dass Deutsche zu beidem fähig sein könnten: zur Pflege einer Erinnerungskultur über den Holocaust, die die Palästinenser miteinbezieht, und gleichzeitig zu einer kritischen Haltung gegenüber Handlungen Israels findet. Das setzt aber voraus, muss man hinzufügen, dass die deutsche Politik sich von ihrem Erinnerungsdogma befreit, was auch eine eigenständige, souveräne Politik gegenüber dem zionistischen Siedlerstaat voraussetzt. Bisher gibt es aber für eine solche Entwicklung keinerlei Anzeichen.
Trotz dieser Kritik soll das Buch von Charlotte Widemann in keiner Weise abgewertet werden. Es arbeitet klar und unmissverständlich die Defizite der westlichen und speziell der deutschen Erinnerungskultur heraus und zeigt dem Titel entsprechende Wege auf, wie wir den Schmerz der Anderen [besser] begreifen können. Eine humanere Welt kann es ohne ein Mehr an Empathie nicht geben. Ihr Buch ist ein wichtiger Beitrag dazu, uns an dieses unumstößliche Faktum zu erinnern und uns für die Schaffung eines globalen Zustandes einzusetzen, der heute noch eine Utopie ist, von dessen Realisierung aber ganz wesentlich die globale Zukunft abhängt.
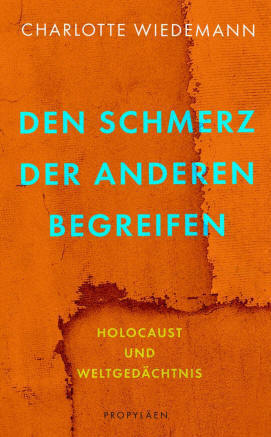
Charlotte Wiedemann
Den Schmerz der Anderen begreifen.
Holocaust und Weltgedächtnis.
Propyläen Verlag, Berlin, ISBN 978-3-549-10049-3, 22 Euro